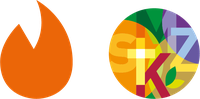So habe ich am letzten Fronleichnamsfest die Gottesdienstbesucher im Pflegeheim angesprochen und kurzfristig für Verunsicherung gesorgt. Viele wussten damit nicht viel anzufangen. Vielleicht geht es Ihnen genauso, weil Sie damit doch eher negative Vorstellungen assoziieren. Denkt man bei einem Kumpel doch meist an jemanden, mit dem man etwas ausheckt.
Aus diesem Grund habe ich Sie natürlich nicht so angesprochen, ganz im Gegenteil. Das Wort »Kumpan« ist zwar ein altes, aber doch wunderbares Wort, das uns das Thema dieser Ausgabe im wahrsten Sinn des Wortes sehr gut erschließen kann. Denn es hat seinen Ursprung im mittelhochdeutschen »kumpan« und geht auf die lateinischen Worte »cum« und »pane« zurück. »Cum« heißt übersetzt »mit«, und »pane« heißt »Brot«. Kumpane sind also diejenigen, die miteinander ihr Brot essen, die also Gemeinschaft haben am selben Brot.
Im Gegensatz zum Alltagsessen, das unserem Lebensunterhalt dient und oft sogar nur schnell alleine zwischen Tür und Angel eingenommen wird, grenzen sich gemeinschaftliche Mahlzeiten dadurch ab, dass sie über Nahrungsaufnahme weit hinausgehen. Wenn wir zu verschiedenen Anlässen zu einem Fest geladen sind oder jemand dazu einladen, feiern wir, weil wir uns freuen und dankbar sind: beispielsweise für die uns bereits geschenkten Lebensjahre oder besondere Lebenswenden. Wir feiern also mit Essen und Trinken gemeinsam vergangene Ereignisse und holen sie durch unsere Erinnerungen in unsere Gegenwart herein.
Daher wundert es nicht, dass das Thema »Essen und Trinken« auch in der Bibel einen großen Raum einnimmt. So ist die hebräische Wortwurzel für »essen« mehr als 900 Mal belegt. Unterschieden werden verschiedene Mahlformen wie einfaches Mahl (Spr 15,17), ein Mahl mit vielen Teilnehmern (2 Kön 6,23), ein Gastmahl (Gen 21,8) oder Kultmahl (Dtn 12,6-7), an dem auch Opfertiere geschlachtet wurden, um nur
einige exemplarisch zu erwähnen. Sie werden mit unterschiedlichen Ausdrücken zur Sprache gebracht. So unterschiedlich sie auch sind, steht bei allen diesen Mahlzeiten immer die Überzeugung im Hintergrund, dass Gott der Geber der Speisen ist (Dtn 32,13).
Viele Traditionen des Mahlhaltens im Judentum sind oft mit spezifischen Speisen und Bräuchen verbunden, die die Bedeutung des jeweiligen Feiertags unterstreichen.
Folgende Feste haben sowohl religiöse als auch kulturelle Bedeutung. Sie erinnern an historische Ereignisse, Naturzyklen und ethische Werte:
Rosch Ha-Schana ist das jüdische Neujahrsfest, das an die Erschaffung der Welt und den Bund zwischen Gott und dem jüdischen Volk erinnert. Yom Kippur ist der Versöhnungstag, an dem streng gefastet und
Einkehr gehalten wird. Das Wochenfest Schawuot erinnert an die Offenbarung der zehn Gebote am Berg Sinai und das Laubhüttenfest, genannt Sukkot, an die vierzigjährige Wanderung des jüdischen Volkes durch die Wüste. Am bekanntesten ist wohl das einwöchige Pessachfest. Während des Sedermahles werden dabei traditionell ungesäuerte Brote (Matzen) serviert, die mit Mazzemehl hergestellt sind und den Auszug aus Ägypten symbolisieren, als man sich nicht die Zeit nehmen konnte, das Brot aufgehen zu lassen.
Wenn wir im NT von einem Mahl hören, denken wir zuallererst an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Das letzte Mahl Jesu war aber nicht das erste Mahl, das Jesus mit Menschen gefeiert hat. Es hat eine Vorgeschichte, die sein gesamtes Wirken durchzieht. Jesus pflegte nämlich selbst eine extensive Mahlpraxis, wie zahlreiche Episoden in den Evangelien zeigen können. Verwiesen sei nur auf jenes Mahl, zu dem Jesus Levi, den er in seine Nachfolge ruft, in sein Haus einlud (Mk 2,13-16). Mit Zöllnern und Sündern sei Jesus zu Tische gelegen, so erzählt Markus. Hier begegnen wir einem wesentlichen Aspekt von Jesu Mahlgemeinschaft, zu der er nämlich alle – auch Leute von zweifelhaftem Ruf – einlud, um mit ihnen zu essen und zu trinken – auch auf die Gefahr hin, dass er von anderen deswegen als Fresser und Säufer beschimpft wurde (vgl. Mt 9,11).
Und im großen Speisewunder hören wir noch heute seinen Appell zum Teilen, wenn er sagt: »Gebt ihr ihnen zu essen!« (Mt14, 16)
Auch nach dem Tod Jesu finden sich Zeugnisse regelmäßiger Mahlfeiern. Paulus erwähnt beispielsweise das gemeinsame Mahl der Gemeinde im 1. Korintherbrief, das er als »Herrenmahl« bezeichnet (1 Kor 11,20).
In Apg 2,46 stellt Lukas dem täglichen Besuch im Tempel das Brotbrechen in den Häusern und das gemeinsame Essen gegenüber. Für ihn bildet das Ritual des Brotbrechens die Brücke zwischen dem letzten Mahl Jesu zum Auferstandenen und zur nachösterlichen Gemeinde. Auf dem Gang nach Emmaus erkennen ihn seine Jünger am Brotbrechen. (Lk 24,30-31). Mit dem letzten Abendmahl schließt er an die Bedeutung an, die das gemeinsame Mahl vor allem in der jüdischen Tradition hat. Die besonderen Worte Jesu waren allen deshalb verständlich, weil sie auch aus dem geregelten Ablauf eines jüdischen Festmahles bekannt waren.
So bricht der Hausvater – auch heute noch – im Anschluss an das Tischgebet das Brot und verteilt es. Im Anschluss an das Dankgebet lässt der Hausvater den Becher mit Wein kreisen und jeden daraus trinken.
Eine Geste der Gemeinschaft, die alle verstanden haben. Jesus brauchte daher keinen neuen Ritus erfinden, sondern ihn nur mit einer neuen Deutung verbinden: Er deutete das Brot und den Wein auf sich selber und hat uns damit eine neue Gemeinschaft verheißen: »communio« mit ihm und untereinander.
Fazit: Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament spielen Mahlzeiten eine zentrale Rolle. In der Bibel sind sie vor allem Ausdruck von Gottesbeziehung, Gemeinschaft, Erinnerung und auch Hoffnung, weisen
sie doch zeichenhaft auf das kommende Reich Gottes hin, das uns Johannes in seiner Offenbarung anschaulich als fröhliches Hochzeitsmahl schildert, zu dem alle eingeladen sind. (Offb 19,7)
Text: August Brückler
Bild: AdobeStock_1583793642