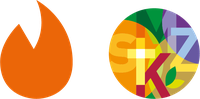Ob aus Stroh, aus Goldpapier oder sogar in der Version von LEDs: »Der Stern von Bethlehem« darf über keiner Krippe oder an keinem Christbaum fehlen: Angeblich hat ein heller Stern am Sternenhimmel vor 2000 Jahren die Geburt Jesu verkündet. Und dieser Stern war gleichsam das Navigationsgerät für die »heiligen drei Könige«! Drei Könige?
Interessant ist die Tatsache, dass wir im Alltag gewöhnlich vom 6. Jänner nicht als Epiphanie, dem Fest der Erscheinung des Herrn, sondern von den »Heiligen Drei Königen« sprechen. Im Neuen Testament steht eigentlich nichts von Königen und auch die Zahl drei wird nicht genannt. Und heiliggesprochen wurden die drei auch nie.
Diese suchenden »Adeligen« kommen nur im Matthäus-Evangelium vor, wo sie als »magoi« (Μάγοι απὸ
άνατολῶν (griechisch, Mágoi apὸ anatolôn) bezeichnet werden, was wörtlich mit »Magier aus dem Osten« übersetzt werden kann. Damit ist wahrscheinlich das Zweistromland Mesopotamien gemeint. In einer alten Keilschrift heißt es: » … dann wird ein großer König im Westland aufstehen, dann wird Gerechtigkeit, Friede und Freude in allen Ländern herrschen und alle Völker beglücken«. Unter »Westland« verstanden die Babylonier damals Palästina. Als »Magoi« wurden gelehrte und weise Männer der hochrangigen, zoroastrischen Priesterkaste bezeichnet, die sich intensiv mit der Sternenkunde beschäftigte und mit ihrem Wissen großen Einfluss auf die Entscheidungen und Urteile der Herrschenden an den Königshöfen ausübte, indem sie den Stand der Sterne als Vorzeichen für das künftige Geschick der Menschen deutete.
Noch heute beeinflussen uns in der Astronomie die Erkenntnisse, die vor Jahrtausenden zwischen Euphrat und Tigris, in der Heimat der biblischen »Magoi« gewonnen wurden. Unser Verständnis des Himmels und der Zeit speist sich aus den Beobachtungen antiker babylonischer Gelehrter. Sie waren es, die den Himmel in 360 Grad aufteilten. Sie legten den Zodiak fest, auf dem unsere Sternkreiszeichen beruhen und die den Sternenhimmel in zwölf Abschnitte teilen – Grundlage für die zwölf Monate des Jahres. Auch die Teilung des Tages in 24 Stunden geht auf die Himmelsbeobachtungen
babylonischer Gelehrter zurück.
Die Übersetzung Marin Luthers der »magoi« als »Weise aus dem Morgenland« ist insofern passender als die sich im frühen 7. Jahrhundert etablierte Bezeichnung »Könige«. Diese bezieht sich wohl einerseits auf die kostbaren Geschenke, die die Sterndeuter laut dem Matthäus-Evangelium dem neugeborenen Kind in der Krippe brachten. Andererseits wird bereits im Alten Testament vorhergesagt, dass der Messias von Königen (Jes 60; Ps 72,10) beschenkt werden wird. Dass es drei persische Weise waren, die Jesus ihre Aufwartung machten, ist schriftlich nicht belegt. Wahrscheinlich geht die Dreizahl auf die Geschenke Weihrauch, Gold und Myrrhe zurück. Gold symbolisiert die königliche Würde Jesu, Weihrauch steht für Göttlichkeit des Kindes und Myrrhe wurde zur Einbalsamierung von Toten verwendet und verweist auf das Menschsein, das Leiden und den späteren Tod Jesu.
Die Namen der Sterndeuter werden ebenfalls nicht genannt. Caspar (persisch: »Hüter des Schatzes«), Melchior (hebräisch: »König des Lichts«) und Balthasar (hebräisch-syrisch: »Gott schütze sein Leben«
oder »Gott wird helfen«) kamen erst im 9. Jahrhundert auf.
Übrigens: Welcher der drei Könige »der Schwarze« ist, ist bis heute nicht geklärt. Die unterschiedliche Herkunft der Namen sollte wohl eher eine Zuordnung der drei Sterndeuter zu den damals bekannten Kontinenten Europa, Afrika und Asien sein. Damit wurde die Bedeutung der Geburt Jesu für alle Menschen der Welt unterstrichen. Die Sternsinger werden heute aus Gründen der Sensibilität und Respekts kaum noch schwarz geschminkt.
Der Brauch der Sternsinger, die zwischen Weihnachten und Epiphanie des Herrn (6. Jänner) von Haus zu Haus ziehen und als die »Heiligen Drei Könige« Spenden sammeln und dem Haus oder der Wohnung für das neue Jahr (Christus Mansionem Benedicat, C+M+B) Segen zusprechen und einen Stern vorantragen, soll das Tun der »magoi«, der Könige als Sterndeuter nachstellen.
Die Schwierigkeit beim »Stern von Bethlehem« ist, dass wir das genaue Datum der Geburt Jesu nicht kennen. Wüssten wir es, könnte man heute mit modernen Computerprogrammen einfach ausrechnen, wie der Sternenhimmel über Bethlehem zu dieser Zeit ausgesehen hat. Für das Jahr 7 v. Chr. haben die Wissenschaften tatsächlich eine spannende Beobachtung gemacht: Die Planeten Jupiter und Saturn, die ja von der Erde aus betrachtet werden können, bewegten sich in diesem Jahr 7 v. Chr. dreimal in auffallender Nähe im Abstand von Monaten - was als helles Himmelsereignis interpretiert werden könnte.
Die »drei Weisen aus dem Morgenland hätten also ausreichend Zeit gehabt, um ins »Westland«, nach Palästina zu reisen und dort nach dem »neuen Stern« zu suchen. Es ist gut möglich, dass auch diese Theorie nicht stimmt. Vielleicht hat es in Wirklichkeit keinen »Stern von Bethlehem« gegeben.
Der Stern von Bethlehem und die komponierte Sterndeuter-Erzählung des Matthäus ist nicht als historischer Report zu lesen. Die Evangelien sind ja keine Tatsachenberichte, sondern theologische Deutungen; sie setzen sich mit der Glaubenstradition Israels auseinander und verkünden, was Gott durch Jesus gewirkt hat. So greift die Geschichte von den Weisen, die dem Stern folgen, auf ein Verheißungswort aus dem 4. Buch Mose zurück: »Ein Stern geht in Jakob auf, ein Zepter erhebt sich in Israel.« (Num 24,17).
Die Sterndeuter sind Suchende: Sie fragen nach dem Sinn und Ziel des Lebens, nach einem Herrscher, der nicht wie Herodes seine egoistischen Interessen im Blick hat, sondern Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen schafft. Sie fragen nach dem Einen, der die Geschicke der Welt und der Menschen in Händen hält und uns Orientierung geben kann. Darin können auch wir uns heute wiederfinden.
Die »Magoi« sind Gelehrte ihrer Zeit: Gottsuche und Glauben stehen also keineswegs im Widerspruch zu Vernunft und Weisheit. Und wir? Sind wir bereit - anders als König Herodes - über uns selbst hinauszuschauen? Wer ist Jesus für uns und was erwarten wir von ihm für unser Leben und unsere Welt?
Text: P. Lukas
Bild: © AdobeStock_214251590.jpeg