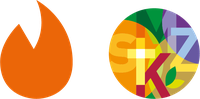»Um an Gott zu glauben, muss ich doch nicht in die Kirche gehen.« Diese Aussage höre ich als Religionslehrer von Jugendlichen häufig, wenn wir über die Kirche oder über die Messe reden. »Ich kann doch auch alleine oder von zuhause aus an Gott glauben. Was brauche ich da den Gottesdienst.«
In diesen Worten verbirgt sich m.E. nicht nur eine vielleicht für Jugendliche typische Skepsis gegenüber (religiösen) Traditionen, vielmehr scheint diese Ansicht spätestens mit den Corona-Jahren mehrheitsfähig geworden zu sein. Das ist jeden Sonntag offensichtlich. Die Frage »Warum soll ich in die Kirche gehen und die Messe mitfeiern?«, scheint mir daher ganz wichtig zu sein und lässt sich wohl nur dann beantworten, wenn wir zuerst darüber reden, was die Messe, der Gottesdienst, die Eucharistiefeier für gläubige Menschen überhaupt ist.
Das Konzilsdokument Lumen Gentium bezeichnet die Messe als »Quelle und Höhepunkt« des Lebens (LG 11).
Das mag sich sehr schön anhören, ist aber gleichzeitig doch einigermaßen sperrig und als Antwort auf die Einwände meiner jugendlichen Schüler*innen nur bedingt geeignet. Zumindest auf den ersten Blick. Tatsächlich aber ist das eine sehr treffende Beschreibung. Wenn wir am Sonntag Eucharistie feiern, dann handelt es sich nämlich nicht bloß um das Vollziehen eines Ritus oder einer Tradition, was es natürlich auch immer ist. Die Feier der Messe rührt an etwas ganz Substantielles in unserem Leben, an eine tiefen Sehnsucht, die alle Menschen in sich tragen. Es ist die Sehnsucht nach Beziehung, nach bedingungslosem Angenommen-Sein. Wie ist das zu verstehen?
Der katholische Theologe und Psychotherapeut Arnold Mettnitzer nennt die Messe das »Sakrament der Ekstase«. Ekstase und Messe – wie passt denn das zusammen? Dazu muss man wissen, mit diesem Begriff ist ein »Außer-sich-Sein« beschrieben. Gehen wir am Sonntag in die Messe, dann treten wir also auf irgendeine Weise aus uns heraus, das heißt, wir verlassen gewissermaßen unser tägliches Ich mit den Sorgen, Verpflichtungen, Gedanken und Zwängen und treten mit etwas ganz Anderem in Beziehung. Ganz bewusst treten wir Sonntag für Sonntag aus unserer Ich-Bezogenheit heraus und treten ein in eine Gemeinschaft von Feiernden, die mich annimmt, wie ich bin.
Damit das gelingen kann, müssen wir uns natürlich öffnen können. Offen-Sein, Da-Sein, absichtslos bereit sein dafür, was mir in der folgenden Stunde begegnet.
Wir wissen selbst nur zu genau, das fällt nicht leicht in einer schnelllebigen Zeit, in der Abwechslung und Zerstreuung oft einfacher gelingen als ruhig werden. Eine Messe mitzufeiern heißt nämlich auch, sich Momenten der Stille und Langsamkeit auszusetzen und das Tempo nicht selbst bestimmen zu können, wie wir es heute zumeist gar nicht mehr gewohnt sind.
Vielleicht sind viele von uns dahingehend tatsächlich ungeübt geworden.
Gelingt uns das aber und wir können uns den Klängen, Gebeten, Erzählungen und Ritualen hingeben, dann treten wir tatsächlich aus uns selbst heraus und folgen dem Aufruf »Erhebet die Herzen« mehr im Sinne von »Geratet endlich einmal außer euch!«, wie Mettnitzer überspitzt formuliert. Wir verlieren uns dann vielleicht im Gesang, versinken in den Lesungen & Gebeten oder schließen die Augen, um noch mehr da zu sein. Oder wir verlieren gar den Anschluss, weil unsere Gedanken in lichte Höhen oder dunkle Tiefen abschweifen.
Unkonzentriertheit? Mag sein. Vielleicht ist das aber Ausdruck von BeGEISTerung und einer Offenheit für die Begegnung mit mir selbst und dem, der mir in der Eucharistie immer begegnen will: Gott. Für den Wiener Theologen ist daher klar, dass die Messe ein »Mysterium tremendum ist, das an die Pforten der Ewigkeit heranführt.« Worte und Beschreibungen reichen dann nicht mehr dafür aus, was mir in diesen Momenten begegnet, was ich fühle oder ahne. Es sind die Momente des Unaussprechlichen und Geheimnisvollen, in denen ich stumm bleiben muss. Auch das etwas Unzeitgemäßes in einer Welt, die alles bespricht, erklärt und kommentiert.
Ganz wichtig erscheint mir an dieser Stelle, dass all dies in einer Form passiert, die überhaupt nicht veraltet oder mittlerweile fremd ist, wie manche der Eucharistiefeier unterstellen. Nein, denn in ihrem Wesen ist sie ein Mahl, und damit ist sie des Menschen ureigenste Form der Begegnung. Von der Taufe bis zum Totenmahl nämlich begehen wir jedes feierliche Miteinander immer auch in einer Form des Miteinander-Essens. Wir laden ein, nehmen uns Zeit, setzen uns dem/der anderen aus und teilen Freuden und Nöte. Nie sind wir Menschen so sehr selbst, wie in jenen Momenten, in denen wir rund um den Tisch zusammenkommen, miteinander essen und trinken. Da ist es doch geradezu logisch, dass wir die Hingabe Jesu an uns Menschen mit einem Mahl erinnern und ihn so in unsere Gegenwart holen. Es mag ein wenig schade sein, dass wir in der kirchlichen Tradition so wenig Sinnliches und Verzehrbares in unser Heute mitnehmen konnten, was am Tisch des letzten Abendmahles begonnen hat. Und dennoch: Es ist und bleibt ein Mahl.
Dieses Mahl ist kein Fast Food, denn es braucht Zeit.
Es ist Gemeinschaft, denn alleine essen wir nicht gern. Es ist Ekstase, weil ich aus meiner Selbstbezogenheit heraustrete. Es ist Hingabe, denn ich teile. Es ist Begegnung, weil »Du« auch da bist.
Oder mit Arnold Mettnitzer: »Die Heilige Messe ist … der idealtypische Ort. Herz, Augen, Ohren, alle Sinne können sich öffnen, um die Welt und unser Leben in neuem Licht zu sehen, nicht nur mit dem Verstand zu begreifen, sondern von innen her ergriffen und heilsam berührt zu sein.«
Alleine von zuhause aus geht das wirklich nicht gut.
Text: Raimund Stadlmann
Bild: AdobeStock_339433441